Deep Purple. Jürgen Roth
Чтение книги онлайн.
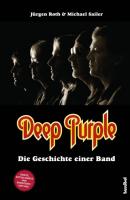
Читать онлайн книгу Deep Purple - Jürgen Roth страница 5
Название: Deep Purple
Автор: Jürgen Roth
Издательство: Bookwire
Жанр: Изобразительное искусство, фотография
isbn: 9783854454144
isbn:
Muß man sich, wie es Christian Gasser, Jahrgang 1963, tut, schämen, daß einst, als die Sex Pistols explodierten und die (musikalische) Revolution auf einen Schlag beendet war, auf der obligaten Liste der eigenen Lieblingssongs Deep Purple gleich zweimal auftauchten, mit „Child In Time“ und „Smoke On The Water“ (mit „Smoke On The Water“ durfte man schon frühzeitig seine Probleme haben, das Stück ist nicht nur ein Objekt der Haßliebe von Herrn Blackmore, sondern von vielen Purple-Anhängern)? Daß unter Gassers fünf „liebsten Sängern“ Ian Gillan auf Position eins zwangsläufig vor dem zweitplazierten Johnny Rotten rangierte? Und Deep Purple den Poll der „Lieblingsgruppen und -musiker“ so unstreitig wie unangefochten halt – anführten? (Zum Beispiel vor den Stranglers, Startnummer fünf.) Ist das alles – jünglinghafte Verirrung? Und heute und hier von Belang?
Für Gasser und dessen schönes Buch (der kennt sogar die wahnsinnigen Genialfinnen Aavikko!) schämen muß man sich ja nicht. Aber hat der Bruder von einem der Autoren, Thomas Roth, nicht recht, wenn er beim luftgitarrenbegleiteten Wiederhören des Siebziger-Jahre-und-Folge-Rock, der Deep Purple essentiell einschließt, brieflich ziemlich prinzipiell niederlegt: „Schlimm genug, den anspruchsvollen Rockisten in mir wiederentdeckt zu haben. Es droht ja noch die Regression auf die Stufe davor, die des unreflektierten Rockisten, des Schlagerhörers unter den Rockern, des durch das Klischee gezähmten Wilden, des Dämlacks und Simpels“?
Ist es eine Not um und mit Deep Purple, eine elende Rechtfertigungsnot? Und müssen denn all diese Fragen wirklich sein? Wenn man nur die Geschichte einer Band aufschreiben und erzählen möchte, so gut es halt geht? Und sich in bestimmten Fragen der Bewertung angenehm bestätigt fühlt, da Ian Gillan in einem Interview für die Sendung Kino & Kult auf n-tv am 5. November 2003 und anläßlich des fünfunddreißigjährigen Bandbestehens in aller Gelassenheit zum besten gibt, man habe nie einen Starrummel um sich betrieben, keine wilden PR-Nummern durchgezogen, einfach Musik gespielt, und deshalb bezahle man den in der Branche nicht unüblichen Preis des Verschleißes eben nicht?
Was indes – Einschub – nicht sein müßte, nicht hätte sein müssen: daß sich Deep Purple am 12. März 2000 nach bis dato einhundertfünfzehn Millionen verkauften Platten dafür hergeben, im Offenbacher Capitol fürs ZDF ein „Deep-Purple-Special“ herunterzukaspern, und sich dabei nicht bloß den idiotischen Fragen eines gewissen Thomas Gottschalk aussetzen, sondern auch noch den schweren Verdacht nähren, die durchaus druckvollen, wenngleich etwas routiniert bewältigten Nummern „Bloodsucker“, „Fireball“, „Woman From Tokyo“ und „Perfect Strangers“ im Playback-Verfahren darzubieten (zu hören bekommen hat man wahrscheinlich Ausschnitte der 1999er Live-Veröffentlichung Total Abandon Australia ’99). Genausowenig hochzuschätzen sind Jon Lords spätere Ausflüge in weitere Gottschalk-Rockveteranen-Fernsehshows zu „Fünfzig Jahre Rock“ et cetera, bis hin zu einem „Cross-over“-Auftritt am 19. September 2004, bei dem Lord im Rahmen der Sunday Night Classics (ZDF) mit Ex-Abba-Sängerin Anni-Frid Synni Lyngstad „The Sun Will Shine Again“ darbot (was wiederum Abba-Fan Blackmore gefallen haben dürfte), jener Lord, der in Offenbach beteuert hatte, auch die nächste Dekade bei Deep Purple verweilen zu wollen, weil sie, die fünf, „mittlerweile“, nach zehrenden Jahrzehnten der Querelen und Zerwürfnisse, „Brüder im Herzen und im Geiste“ seien.
Aber vergessen wir das.
Ein wahres, adoleszentes Moment der Faszination des Jugendlichen für Deep Purple hat Nick Hornby festgehalten. Es macht sich fest an einem Bedürfnis aus gewissen Zeiten, die Qualität eines Songs daran zu messen, ob er ein donnerndes Gitarrensolo enthält – oder wenigstens ein monolithisches Riff, ein „Soundgebirge“ – und ob es, das Solo, auch lang genug sei. Hornby schreibt in 31 Songs (Köln 2003), im Kapitel zu „Heartbreaker“ von Led Zeppelin, es gebe „eine nicht pathologische, sondern musikalische Erklärung für mein kindliches Liebäugeln mit Zeppelin und Sabbath und Deep Purple, nämlich, daß ich meinem Urteil über einen Song nicht traute. Wie ein prätentiöser, aber begriffsstutziger Erwachsener, der sich einen Film nur ansieht, wenn er Untertitel hat, hörte ich mir nichts an, das nicht unter lauten, kreischenden E-Gitarren begraben war. Woran hätte ich sonst erkennen sollen, ob das Stück irgendwas taugt?“
Schon wieder eine Frage. Und noch eine: Ist sie, die Frage, unter den Jahren der Jugend begraben worden? Wer weiß. Eventuell nicht. Wer im Jahr 2004 den wiederauferstandenen Eddie Van Halen hört, könnte sie ernst nehmen und ohne Achselzucken beantworten. Oder wer, wie der sehr saubere Herr Michael Rudolf und dessen Frau, Steve Vai, Frank Zappas ehemaligen Angestellten für „guitar abuse“, leibhaftig erlebt. Oder wer eine Platte von Deep Purple auflegt, Bananas nämlich, auf der Steve Morse endlich wie ein Gitarrist, der in einer Band spielt, zu agieren und zu klingen beginnt. Oder wer diesen einen Solotonausreißer auf Ritchie Blackmores Rainbow-LP Stranger In Us All (1995) vernimmt, versteckt in einem perlenden Zufallslauf im zwischen wärmender Melodieführung und „Burn“/„Can’t Happen Here“-Riffgebretter changierenden „Too Late For Tears“ – der könnte Nick Hornby noch heute unvermindert folgen. Er muß ja deshalb nicht gleich eine Revolution anzetteln. Oder seinen Plattenschrank nach selbiger Maßgabe sortieren. Aufräumen. Bereinigen.
Daß sich mit der Musik von Deep Purple etwas Humanes, im guten Sinne ungetrübt Naives zu verbinden vermag, meldet Richard Linklaters großartiger Kinofilm School of Rock an. Jack Black, der in der Hornby-Verfilmung High Fidelity einen Plattenverkäufer mimte, wie Christian Gasser, der einer war, wahrscheinlich gern einer gewesen wäre, gibt da einen Spinal Tap-verdächtigen Rockgitarristen, der auf der ganzen koksfreien Linie gescheitert ist und sich einen Job als Aushilfslehrer an einer Upper-class-Schule erschleicht. Und dann passiert etwas, das unerwartet zu Tränen rührt: Jack Black – warum eigentlich nicht Jack Blackmore? – bringt die verkniffenen, knieseligen und spießigen Racker zum Rocken, er führt sie ins Leben, und er tut dies auch mit dem Initialriff von „Smoke On The Water“. Grundton, Quinte, und endlich wissen wir, was es heißt, als Klein- oder Großbürger noch heute an der Revolution teilnehmen zu dürfen: „Wir haben zu rocken.“ (Jack Black) Weil wir hier rückblickend neuerlich „den noch in den Anfängen steckenden Hard Rock revolutionieren“ (Rock Hard), aber mindestens.
Das alles hat weder etwas mit mühsamer Ehrenrettung noch mit Romantizismus zu tun. Daß „Smoke On The Water“ einiges mit „My Generation“ am Hut hat, läßt sich belegen. Und gleichzeitig läßt sich begründet darüber schreiben, warum „Smoke On The Water“ weiß Gott nicht alles ist, was Deep Purple waren und sind. „Das ‚Smoke On The Water‘-Riff“, legte die taz zu School of Rock nieder, „dürfte an keinem noch so dilettantischen Gitarrenschüler vorbeigegangen sein“, und das ist so wahr wie in seiner Stoßrichtung falsch. Denn kein Gitarrist hat die abgehackte Folge gezupfter Zweisaitenchords jemals so intoniert wie der böse schwarze Mann an der weißen Strat (Steve Morse versucht es, aber sein Sound ist einfach zu fett). Darin liegt der Hund von Deep Purple begraben. Unter anderem. Und darin zeigt sich, СКАЧАТЬ