Anatomie des Handy-Menschen. Matthias Morgenroth
Чтение книги онлайн.
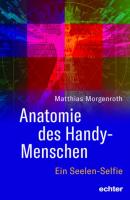
Читать онлайн книгу Anatomie des Handy-Menschen - Matthias Morgenroth страница 6
Название: Anatomie des Handy-Menschen
Автор: Matthias Morgenroth
Издательство: Bookwire
Жанр: Религия: прочее
isbn: 9783429064891
isbn:
Erfühlen? Schwierig, wirst du vielleicht sagen. Bleiben wir doch lieber bei den harten Fakten! Aber warte. Vielleicht ist das Fühlen-Können ja genau eine der Fähigkeiten, die uns von der digitalen Sicht auf uns Menschen unterscheidet. Wir sind fühlende Denker. Oder denkende Fühlende. Als Einheit. Das ist schließlich auch die Hoffnung der Hoffnungsvollen, dass wir am Ende durch die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz und den digitalen Welten einen neuen, geklärten Blick aufs Menschlich-Sein und In-der-Welt-Sein bekommen. Es gilt nicht nur der Kampfruf der Aufklärung sapere aude, wage zu denken! Es gilt auch sentire aude – trau dich zu fühlen!
Korrektur des Verstandes: Sentire aude
Denn von allen Seiten wird derzeit eine neue Aufklärung gefordert, durchaus im Kant’schen Sinne, von dem der Kampfruf sapere aude bekanntlich stammt. Wir sollen wieder mündig werden. Wir sollen uns aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien, aus dem Diktat der neuen Gesetzmäßigkeiten der Digitalisierung. Die Stimmen sind durch die Diskussion über die Reanimierung der Gesellschaft mit oder nach Corona gerade in den Hintergrund getreten – auf bedenkliche Weise. Denn dass uns das Digitale über manche Ausgangsbeschränkung hinweggeholfen hat, ist noch kein Argument, es weiterhin unbedarft zu umarmen.
Geistesgeschichtlich betrachtet, hat die Epoche der Aufklärung schon wenige Jahrzehnte später durch die Romantik eine notwendige Korrektur erfahren. Als die Aufklärung in der Folge Immanuel Kants alles auf den Prüfstand des rationalen Denkens stellen wollte, alles in Frage stellte, alles, was bisher geglaubt wurde, erklären und damit relativieren wollte, wurde schnell die Kehrseite des Unterfangens deutlich. Eine nur rationale Welt hat keinen Sinn mehr. Sie ist kaltes Gehäuse. Sie funktioniert nach Mechanismen. Und der Mensch in ihr funktioniert auch nach Mechanismen. Nicht, weil er Sinn macht. Auch die großen Erzählungen, wozu die Welt und wir in ihr da sein könnten, wurden ja dekonstruiert, in Einzelteile zerlegt und historisch eingeordnet. Alles lässt sich seither wegerklären, sogar der Glaube an Götter oder einen Gott. Und auch der Mensch lässt sich wegerklären. So funktioniert der Körper eben. Oder das Gehirn. So funktioniert Biologie.
Knapp zwei Jahrzehnte nach Kants berühmter Maxime sapere aude formierte sich daher Widerstand gegen die totale Skelettierung des Sinns, der Münchner Theologe Hermann Timm hat die Romantik daher „heilige Revolution“16 genannt. Sie hat eine wichtige Korrektur geschaffen, um das Leben und alles, was ist, zu beschreiben: Das Leben trägt, so würden wir es heute vielleicht ausdrücken, den Sinn in sich. Und wir haben die „heilige“ Aufgabe, uns ganz individuell diesen Sinn zu erschließen. Die Romantiker griffen zu den Mitteln der Dichtung, der Poesie, die eben genau das Erspüren und Fühlen fördern sollte. Joseph von Eichendorff in seinem berühmten Gedicht „Wünschelrute“ bringt es so auf den Punkt: „Schläft ein Lied in allen Dingen, / Die da träumen fort und fort, / Und die Welt hebt an zu singen, / Triffst du nur das Zauberwort.“17
Uns neu erzählen: Methode Übertreibung
Dieses Zauberwort zu treffen ist bis heute die Aufgabe, die du und ich zu lösen haben, und das, ohne dabei wieder naiv, vorrational auf die Welt zuzugehen. Das geht, wenn wir Welt und Leben nicht „wegerklären“, sondern unsere Lebenswelt und unser Leben ganzheitlich „wahrnehmen“. Denken wir also nach und fühlen uns dabei zugleich. Durchleuchten wir unseren Leib und spüren in die Veränderungen hinein. Unserem Net-Doktor wird einiges Neuartige an uns auffallen, von dem wir noch nicht so recht wissen, ob es gutartig oder bösartig oder beides ist. Wenn uns eines die Corona-Pandemie wieder in Erinnerung gerufen hat, ist es das, dass wir Sterbliche geblieben sind, ungeachtet aller Rationalität.
Eine wichtige Methode dabei ist die Übertreibung, wie es schon Günther Anders vorschlug, denn sonst würden die Phänomene „unidentifizierbar“ oder „unsichtbar“ bleiben.18 Und das ist in unserem Fall manchmal paradox: Es bedarf der Übertreibung dessen, was „zu groß“ ist, als dass wir es im Normalfall wahrnehmen. Es übersteigt unseren Horizont. Oder die Veränderungen sind zu minimal, als dass wir darüber im Normalfall nachdenken. Übertreiben, überspitzen, überpointieren wir es also, dann merken wir, was „es“ mit uns macht und was wir mit dem neuen digitalen Lebensgefühl machen wollen, können, dürfen oder lieber bleiben lassen sollten. Fangen wir an, uns neu zu erzählen.
Mit dem ganzen Leib: Phänomenologie
Du könntest diese Anmerkungen zur Anatomie des Handy-Menschen auch „Phänomenologie des Handy-Menschen“ nennen. Denn mit Edmund Husserl teile ich folgende These der philosophischen Schule, die sich Phänomenologie nennt: Der Sinn und die Bedeutung von irgendetwas liegt nicht dahinter verborgen, sondern mitten darin. Er geht uns nicht auf, indem wir das Phänomen, um das es geht, (psychologisch, biochemisch, soziologisch etc.) erklären und damit letztlich zum Verschwinden bringen, sondern indem wir es genau und immer präziser beschreiben, in Zeitlupe nachverfolgen oder bewusst vergrößern. Sodass wir das, was wir beobachtet haben, in Worte fassen, um es erst mal richtig sichtbar zu machen. Wir müssen, um „zu den Sachen selbst“ zu kommen, gerade alle Theorien, Vormeinungen, ja unser „Wissen“ ausklammern.
Mit Hermann Schmitz, dem Begründer der neuen Phänomenologie, der jahrzehntelang an einer Phänomenologie des menschlichen Leibes gearbeitet hat, teile ich den Gedanken, dass wir Menschen uns nicht in Körper und Seele auftrennen sollten, nicht in Verstand und Gefühle, um uns zu verstehen. Wir sind ein Ganzes, wir nehmen uns und die Lebenswelt als Ganzheit wahr. Wir erfahren uns und die Welt nicht rein körperlich, nicht rein seelisch, nicht rein sinnlich, nicht rein gedanklich, sondern mit dem ganzen „Leib“, wie Hermann Schmitz es nennt. Er fügt hinzu: Es sind daher auch gar nicht die Gedanken, die uns zu dem machen, was wir sind, sondern die Gefühle, die uns gleichsam von irgendwoher ergreifen und maßgeblich in unser Leben eingreifen. So kommt Schmitz auf ganz neue Schlüsselszenen dessen, was uns ausmacht und was uns bestimmt.19
Und schließlich finde ich den Gedanken des Philosophen und Soziologen Max Scheler sehr plausibel, dass sich auch das Gute intuitiv „erfühlen“ lässt. Dass sich „Werte“ erfühlen lassen. Dass wir uns zu ihnen hingezogen fühlen, mit dem ganzen Leib, unmittelbar, intuitiv, so dass es uns kalt den Rücken runterläuft oder sich uns die Haare aufstellen, wenn etwas unseren Werten zuwiderläuft. Und dass wir sehr wohl unterscheiden können: zwischen persönlichen Vorlieben und „höheren Werten“, die dauerhaft sind, Einheit stiften, eine überindividuelle tiefe Befriedigung bringen oder die sogar so absolut erfahrbar werden wie die Würde. Und dass es gerade deshalb darauf ankommt, das Fühlen zu trainieren und mögliche Abgestumpftheit zu überwinden, um zu merken, was guttut und was gut ist.20
Illtümer: Was wir glauben, muss nicht stimmen
Es gibt bei unserem Zusammenleben mit dem Smartphone nicht nur Abstumpfungen, sondern auch grundlegende Verunsicherungen. Für Erstere habe ich bei dem österreichischen Sprachakrobaten Ernst Jandl das treffende Wort ILLTUM gefunden. Illtum ist eines der schönsten Worte, die es gibt bzw. nicht gibt. Es stammt aus Jandls Gedicht „lichtung // manche meinen / lechts und rinks / kann man nicht / velwechsern. / werch ein illtum!“21
Illtum ist für mich eine folgenreiche Mischung von Irrtum und Illness. Ein krankmachender Irrtum, mehr zu fühlen als zu definieren. Gut gemeint, aber damit das Gegenteil von gut – doch, und das ist das Entscheidende, wir bemerken es nicht. Einfaches Beispiel: Das Internet, der digitale Weltinnenraum, ist u. a. geboren aus dem Aufbruchsgeist der Hippies, verknüpft mit dem Fortschrittsgedanken, СКАЧАТЬ