Verfahrenstechnik für Dummies. Burkhard Lohrengel
Чтение книги онлайн.
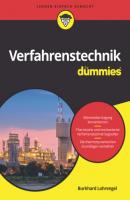
Читать онлайн книгу Verfahrenstechnik für Dummies - Burkhard Lohrengel страница 28
Название: Verfahrenstechnik für Dummies
Автор: Burkhard Lohrengel
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Жанр: Техническая литература
isbn: 9783527827008
isbn:
Dampfdruck
Beginnen wir mit einer Definition:
Der Dampfdruck hängt vom verdampfenden Stoff sowie der Temperatur ab. Abbildung 2.20 zeigt die Zusammenhänge. Ein Behälter mit Flüssigkeit ist bei tiefer Temperatur (T 1) von einem beweglichen Kolben verschlossen. Es existiert keine Dampfphase, der Dampfdruck (p 0) ist null. Wird die Flüssigkeit durch Energiezufuhr auf die höhere Temperatur T 2 erwärmt, bildet sich über der flüssigen Phase auch eine Dampfphase aus, da einige Moleküle durch die Energiezufuhr eine ausreichend hohe kinetische Energie besitzen, um die intermolekularen Anziehungskräfte in der Flüssigkeit zu überwinden und in die Gasphase überzugehen. Die freigesetzten Moleküle üben einen Druck auf die Gefäßwände aus. Der entstandene Dampfdruck kann gemessen werden. Durch weitere Wärmezufuhr verdampft immer mehr Flüssigkeit, der Flüssigkeitsanteil wird dadurch immer geringer, der Dampfanteil und damit der Dampfdruck steigt an.
Abbildung 2.20 Dampfdruck
Der Dampfdruck für eine Komponente i lässt sich sehr gut mit der von Antoine vorgeschlagenen Korrelationsbeziehung
(2.21)
beschreiben. A, B und C sind stoffabhängige Konstanten. In Formel 2.21 müssen Sie den Druck in bar, die Temperatur ϑ in °C angeben.
Einsetzen der Temperaturen führt zu den gewünschten Dampfdrücken:
Sie sehen: der Dampfdruck steigt mit der Temperatur. Dies wird auch aus Abbildung 2.19 deutlich.
Verdunstung
Was passiert aber mit Ihrer Wäsche, die Sie im Sommer zum Trocknen ins Freie hängen? Sie trocknet, das Wasser wird aus den Wäschestücken entfernt und geht in den gasförmigen Zustand über, ohne dass die Siedetemperatur von 100 °C erreicht würde. Das Gleiche passiert mit Wasserpfützen, die sich nach einem Regenguss gebildet haben, bei trockenem Wetter aber bald wieder verschwinden.
Dieser Vorgang wird als Verdunstung bezeichnet. Er kann nur funktionieren, wenn die Luft nicht wassergesättigt ist, also noch Wasser aufnehmen kann, wie schon bei der relativen Feuchte beschrieben. Ist die Luft nicht gesättigt, kann die Luft Wasser bis zur Sättigung aufnehmen.
Der Verdunstungsvorgang wird gefördert durch (das kennen Sie vom Aufhängen Ihrer Wäsche):
eine niedrige Luftfeuchtigkeit, im Volksmund also trockene Luft,
eine starke Luftbewegung über der Flüssigkeitsoberfläche, also möglichst windigem Wetter,
eine große Oberfläche des Stoffs, aus dem etwas Verdunsten soll (daher hängen Sie Ihre Wäsche möglichst breit auf und schmeißen sie nicht einfach als Klumpen auf die Wäscheleine),
einen geringen Abstand des verdunstenden Stoffs von der Siedetemperatur (daher trocknet Ihre Wäsche bei warmem Wetter besser als bei kaltem).
Wie kommt es aber zum Verdunstungsvorgang? Denken Sie an das Teilchenmodell der Flüssigkeit zurück. Die Teilchen in der Flüssigkeit besitzen eine Geschwindigkeitsverteilung, es kommen alle Geschwindigkeiten von sehr niedrigen bis zu sehr hohen Werten vor. Den schnelleren Teilchen gelingt es, trotz der Anziehungskräfte der Nachbarteilchen, die Flüssigkeit zu verlassen. Weht noch ein Luftzug über die Wasseroberfläche, werden die schnellen aus der Flüssigkeit ausgetretenen Teilchen sofort von der Oberfläche entfernt. Es können weitere »schnelle« Teilchen austreten. Auf diese Weise sinkt in der Flüssigkeit die Durchschnittsgeschwindigkeit der hier verbliebenen Teilchen und somit auch die Temperatur der Flüssigkeit. Außerdem wird das Flüssigkeitsvolumen mit der Zeit geringer.
Hunde haben es da schon wesentlich schwerer, da sie nur an den Pfoten Schweißdrüsen haben. Diese reichen bei Weitem nicht aus, um die Körpertemperatur zu regulieren. Daher hechelt ein Hund. Bei geöffnetem Maul und heraushängender, feuchter Zunge kann er über die dort stattfindende Verdunstung zumindest etwas überschüssige Wärme aus dem Körper abgegeben.
Sie haben bemerkt, dass die Verdunstung dazu führt, dass sich die verdunstende Flüssigkeit abkühlt. Dieser Vorgang wird als Verdunstungskühlung bezeichnet.