Deep Purple. Jürgen Roth
Чтение книги онлайн.
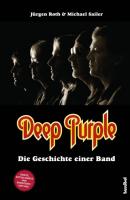
Читать онлайн книгу Deep Purple - Jürgen Roth страница 32
Название: Deep Purple
Автор: Jürgen Roth
Издательство: Bookwire
Жанр: Изобразительное искусство, фотография
isbn: 9783854454144
isbn:
Leserbrief in Sounds, Mai 1971
Am 10. Juli 1969 stellt die Firma Deep Purple im Speakeasy in der Londoner Margaret Street, dem derzeit angesagtesten Treffpunkt für alle, die sich irgendwie mit Rockmusik befassen, unter dem etwas anmaßenden Motto „Back from their second successful USA tour!“ ihr neues Personal vor. „Es war umwerfend“, schreibt Ian Gillan in seiner Autobiographie, „das Machtgefühl war unbeschreiblich.“ Da könnte man ein kollektives Seufzen der Erleichterung hören, wenn die Musik nicht so laut wäre. Zwar müssen Gillan und Glover danach noch zwei letzte Male zum Dienst mit Episode Six antreten, aber inzwischen wissen alle, was los ist, und haben sich auf unterschiedliche Weise akkommodiert. Gloria Bristows Schaden ist der Trubel letztlich nicht: Sie kassiert dreitausend Pfund von HEC, holt den Sänger und Bassisten Johnny Gustafson als Gillan/Glover-Ersatz zu Episode Six und investiert dann aber den größten Teil der Summe in die neue Band von Gustafson und Mick Underwood mit dem studierten Organisten Pete Robinson – Quatermass.
Ian Gillan wiederum hat bei den Proben gemerkt, daß ein Sänger eigentlich das ist, was Deep Purple im Notfall am allerwenigsten bräuchten: „Andere Bands benutzten das Wort Improvisation, um ihre Unfähigkeit zu kaschieren, aber bei Deep Purple war das wirklich was. Die Musik hatte etwas Abstraktes, was damals sehr radikal war. Und sie hatte etwas speziell Deep-Purple-Artiges, ganz anderes als Led Zeppelin, Jethro Tull und Black Sabbath. Die Strukturen, das Gespür, die fließenden Tonartwechsel, die Riffs, die Arrangements, die Dynamik, diese kolossale Dynamik. Die Musik war vom Aufbau her allem, was andere Bands machten, Lichtjahre voraus oder wenigstens Lichtjahre davon entfernt. Purple wurden ein Monster der individuellen Beiträge.“
Was Professor Gillan meint, ist freilich etwas anderes. Nicht abstrakt ist sie, diese Musik, sondern, um im Jargon des Kunstschubladendenkens zu bleiben, konkret: „Die Benennung“, erklärt der Brockhaus, „soll hervorheben, daß die Gestaltung hier nicht von einem Abstraktionsvorgang ausgeht, sondern vom unmittelbaren Umgang mit den konkreten Bildmitteln.“ Und andererseits entwickelt sie eine ebenso, na ja, konkrete Sogwirkung, der sich zumindest die beteiligten Musiker nicht zu entziehen vermöchten, wenn sie denn wollten. „In den frühen Tagen war es wie Jazz“, meint Roger Glover, „eine Art Rockjazz, es hatte diese Freiheit.“ Für Ian Gillan ist die Freiheit, die sich seine Kollegen nehmen, ein bißchen zu viel. Um während der solistischen Eskapaden und Improvisationsorgien nicht auf der Bühne herumzustehen wie ein Ölgötze oder gar Robert-Plant-Ekstasenposen simulieren zu müssen, stellt er sich zwei Congas unters Mikrophon und wird damit zum vielleicht ungehörtesten Instrumentalisten der Rockgeschichte. Eine seltsame Idee, doch davon hat Gillan viele, wie sich Jon Lord 1993 erinnern wird: „Ian war anfangs irgendwie ein Fremdkörper in der Band. Er wußte nicht, was er mit seiner wundervollen Stimme anfangen sollte. Roger ist so etwas wie Ians Dolmetscher. Das geht so, daß Ian wirklich merkwürdige Ideen für seinen Gesang daherbringt, einfach um mal zu sehen, ob was draus wird, und die Ideen stürzen dann ab und gehen in Flammen auf, und es ist Rogers Aufgabe, das Feuer zu löschen und die Trümmer aufzusammeln. Niemand in der Band weiß, wohin Ian mit einem Song will – außer Roger.“
Als frischgebackener Star stellt Gillan neben der Musik noch so einiges an, was er später in unnachahmlicher Diktion so zusammenfaßt: „Mit dem neuen Selbstvertrauen, das viele Leute manchmal als Arroganz empfanden, ließ ich mich frohgemut in den Rocklebensstil hineinfallen, der im Speakeasy als Mikrokosmos existierte. Es wurde ein wahrlich berühmter – oder sollte ich sagen: berüchtigter? – Treffpunkt, wo man in dem heißen kleinen Restaurant essen konnte oder einfach an der Bar sitzen und mit jemandem quatschen, dessen Show man vor einiger Zeit gesehen hatte. Dann wurde einem immer mal nebenbei einer geblasen, während man das nächste Bier bestellte. Selbstverständlich ohne das Gespräch zu unterbrechen. Wir pflegten zu sagen, das ideale Groupie müsse einen Meter zwanzig groß sein und einen flachen Kopf haben, damit man sein Bier wo abstellen konnte. Der Laden war wirklich komplett dekadent.“ Und Gillans Lebensgefährtin Zoe verrät dem Record Mirror: „Wir führen ein ruhiges Leben – auf Partys sind wir nie anzutreffen.“
Was der neuformierten, während Bootsfahrten auf der Themse menschlich aneinander akklimatisierten und durch die wohlwollenden Kommentare zu den ersten Auftritten seelisch gewärmten Band fehlt, ist ein neues Programm, um den neuen Geist kompakt und tonträgergeeignet umzusetzen. Das Hanwell Community Centre im Londoner Westen (wo sonst?), 1856 als Armenschule erbaut und später Schauplatz diverser Konzerte späterer (und nun auch ehemaliger) Deep-Purple-Mitglieder, ist seit einiger Zeit zur Übungsstätte aller möglichen Bands umfunktioniert. „Es war der einzige Ort, wo man soviel Lärm machen konnte, wie man wollte“, sagt Roger Glover, und der Lärm, den Deep Purple dort ab Juni 1969 veranstalten, ist so immens, daß die anderen Musizierenden nicht selten entnervt ihre Bemühungen einstellen und entweder nach Hause gehen oder dabeibleiben und lauschen – und dabei hellhörig werden, wie zum Beispiel die hoffnungslose Möchtegern-Progressive-Blues-Truppe Spice, deren Sänger David Byron Jahre des Nachäffens später mit mehr als einer Prise Chuzpe behaupten wird: „Wir haben Deep Purple sehr genau zugehört, und sie haben uns sehr genau zugehört.“ Da heißen Spice längst Uriah Heep, haben sich „auf Anraten der herrschenden Mächte“, wie ihr Biograph Robert M. Corich das mit einem laut klappernden Augenzwinkern formuliert, einen Orgler angeschafft und tragen immer noch ein gerüttelt Maß dazu bei, den Hard Rock bei denkenden und fühlenden Menschen für alle Zeiten zu diskreditieren. „Ich erinnere mich, wie Jon Lord und ich mal von einem Gig zurückkehrten“, sagt Roger Glover später zu Dave Thompson. „Wir kamen in die Wohnung, schalteten den Fernseher an, und da sahen wir eine Band, und da fiel uns die Kinnlade runter: Die machten alles genauso wie wir! Lange Gitarrensoli, einfältige Songs, derselbe Sound, dieselbe Mischung aus Orgel und Gitarre. Wir dachten: ‚Was zum Teufel ist das denn?‘“ Na was wohl?
Statt David Byron glauben wir schon eher Ian Paice: „Innerhalb kurzer Zeit, vielleicht drei oder vier Wochen, stellten wir fest, daß alles möglich war und daß alles in uns selbst lag. Wir mußten auf nichts hören und uns an nichts orientieren, und das war wirklich spannend.“ Die alten, pompösen Legierungen von schwerfälligen Akkordfolgen mit klassischen Einsprengseln findet nun auch Jon Lord „seelenlos“ und „zu geplant“. „Wir glauben ans Experimentieren“, sagt er in einem Interview mit Beat Instrumental. Ritchie Blackmore sieht die Sache aus einem Abstand von gut zwei Jahrzehnten ein bißchen nüchterner: „Wir wollten anfangs ein Vanilla-Fudge-Klon werden. Aber Ian Gillan wollte Edgar Winter sein. Ich hatte ihm White Trash vorgespielt und gesagt: ‚Hör dir mal diesen Schrei an.‘ Und er sagte: ‚Ich möchte so schreien wie Edgar Winter!‘ Das war’s also, was wir darstellten: Vanilla Fudge mit Edgar Winter.“
Zunächst schafft sich „Edgar“ Gillan alte Klamotten wie „Hush“ und „Kentucky Woman“ drauf, was aber, da sein Drei-Oktaven-Organ von den Drei-Ton-Melodien der Fremdhits unterfordert ist, schnell langweilig wird. Dann kommt Roger Glovers Einsatz: Als Ritchie Blackmore von dem nicht zuletzt als Songlieferant Eingekauften etwas ruppig Schnelles fordert, um Konzerte angemessen beginnen zu können, das am besten auch noch viel mit Jimi Hendrix’ „Fire“ zu tun haben soll, schüttelt Glover eine Figur aus den Fingern, bastelt ein wenig dran rum – weniger um ihre Herkunft zu verschleiern, als um Hendrix’ notorisch fahrige Riffkonstruktion solide notierbar zu machen; Ian Gillan knittelt ein paar Verse über oralen Geschlechtsverkehr dazu, und fertig ist der erste neue Song: „Kneel And Pray“. Oder nicht ganz: Später heißt er „Ricochet“, dann endlich „Speed King“.
Die Ruck-zuck-Arbeitsweise wird zum Markenzeichen nicht nur für Deep Purple (die diese später mit „Black Night“ perfektionieren), sondern auch nicht wenige Heavy-Kollegen. „Good Times Bad Times“ beziehungsweise „Communication Breakdown“ von Led Zeppelin und „Paranoid“ von Black Sabbath dienen demselben Zweck einer bombigen Showeröffnung, mit der man ein lauwarmes Publikum angemessen entflammt oder Plattenfirmen Material für in progressiven Kreisen verpönte СКАЧАТЬ