Von der Familie zur Gruppe zum Team. Dr. Hans Rosenkranz
Чтение книги онлайн.
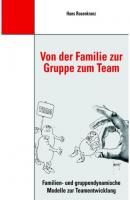
Читать онлайн книгу Von der Familie zur Gruppe zum Team - Dr. Hans Rosenkranz страница 3
Название: Von der Familie zur Gruppe zum Team
Автор: Dr. Hans Rosenkranz
Издательство: Bookwire
Жанр: Изобразительное искусство, фотография
isbn: 9783844228014
isbn:
Ich will sowohl aus der Perspektive eines Trainers und Beraters von Teams und Organisationen als auch der eines Familientherapeuten berichten, wie ich meinen Klienten helfe, ihre Mitte zu finden und ihre Energien und Ressourcen zu nützen. Ich berichte von meinen eigenen Erfahrungen und ziehe Modelle aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Therapieformen zur Erklärung hinzu. Darüber hinaus schildere ich die praktische Trainings- und Beratungskonzeption, wie ich sie, zusammen mit Kollegen und Klienten, in den letzten 40 Jahren angewendet und entwickelt habe. Im ersten Teil konzentriere ich mich mehr auf das soziale Geschehen und seine anthropologischen Grundlagen, im zweiten Teil auf Möglichkeiten, den Prozess durch Intervention zu gestalten.
Das Problem mit dem Überleben
Nach der pessimistischen Analyse Arthur Koestlers ist der Mensch ein »Irrläufer der Evolution«. Er ist im Grunde geisteskrank, dem Gesetz des Dschungels in einem Kampf jeder gegen jeden verfallen und leidet an einer »fast schizophrenen Spaltung zwischen Vernunft und Emotion«.10 Arnold Gehlen11 hat den Menschen als »organisches Mängelwesen« beschrieben, Adolf Portmann12 nannte den Homo sapiens im Vergleich mit den höchstentwickelten Säugetieren eine »extrauterine Frühgeburt«. Ungünstige Startbedingungen für den neugeborenen Menschen kommen auch aus Untersuchungen in Wien und Stockholm über die Einstellungen schwangerer Mütter zum Ausdruck. Zwei Drittel aller Mütter wiesen eine mehr oder minder intensive offene oder verdrängte Feindseligkeit gegenüber dem werdenden Kind auf. Lediglich bei einem Drittel der Mütter könne man sagen, sie seien »guter Hoffnung«.13
Es mutet geradezu erstaunlich an, dass der Mensch trotz allem überlebt. Alles scheint überlagert zu sein von der Angst, auf dieser Welt nicht genügend Platz und Möglichkeiten zum Überleben zu finden. Neben Kräften zur Selbstzerstörung haben wir auch Fähigkeiten, diesen negativen Prozess zu wenden, indem wir unseren Mangel an Instinkten durch Denken und Lernen überwinden. Wir haben die Chance, unsere Konfliktträchtigkeit und soziale Abhängigkeit durch Kommunikation und Kooperation zu kultivieren. Energien, die unkontrolliert unsere Entwicklung hemmen, können wir umkehren zum Ausgleich von Defiziten und zur Lösung von Überlebensproblemen. Die Voraussetzung dazu ist allerdings, dass wir mit dieser Überlebens-Urangst umgehen lernen.
Die Angst, nicht zu überleben oder nicht in dem Stil zu überleben, wie wir uns das vorstellen, reduziert in vielerlei Weise unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Dies zeigt sich in gruppendynamischen Situationen, wenn wir Gelegenheit haben, uns durch andere mit unserem Selbstbild konfrontieren zu lassen.
Selbstbild und Fremdbild
Während in wissenschaftlichen Feldstudien Aussagen über häufig auftretendes menschliches Verhalten gemacht werden, setzt das gruppendynamische Laboratorium sich selbst zum Forschungsgegenstand. So werden in einer für die Teilnehmer relativ sicheren Umgebung Lernsituationen bereitet, die einen Vergleich des Selbstbildes mit den Fremdbildern der Gruppenkollegen ermöglichen. Die Teilnehmer übernehmen dabei sowohl die Rolle des Forschenden als auch die Rolle des Forschungsgegenstandes.
Beschreiben wir uns selbst, so drückt sich in dieser Beschreibung unser Selbstbild aus, d. h. wir beschreiben uns so, wie wir uns selbst sehen, z. B. »Ich bin Angestellter bei der Firma Y und habe dort die Aufgabe, Verkäufer zu trainieren. Ich bin eine Führungskraft, da ich andere anzuleiten und zu motivieren habe. Ich glaube, dass ich einen guten Job tue, da ich sieben Jahre Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin 43 Jahre alt, schaue einigermaßen gut aus, habe Erfolg bei den Frauen, bin ein guter Tischtennisspieler und ein mittelmäßiger Fußballspieler, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, bin ein relativ partizipativer Vater, ein etwas direktiver Vorgesetzter, usw.«
Die Beschreibung ist subjektiv, d.h. sie ist vom Standpunkt des betroffenen Individuums/Subjekts aus gemacht. Sie ist eine psychologische Realität und von daher richtig - subjektiv richtig. Wollen wir uns aber mit dieser subjektiven Richtigkeit nicht begnügen, sondern unser Selbstbild in den sozialen Kontext einer stärker objektiven, d. h. auch von anderer Sicht aus gesehenen Perspektive überprüfen, so haben wir uns die Frage zu stellen: Wie sehen mich die anderen? Speziell diejenigen, mit denen ich am meisten zu tun habe - also die Familie, die Frau, die Kinder, die Freunde, die Mitarbeiter und Kollegen, Vorgesetzte und Kunden.
Solche Informationen über sich selbst sind von anderen in der rauen Wirklichkeit des Betriebes, der Behörde, der Schule etc. nur schwer, wenn überhaupt erhältlich. Es besteht ferner die Gefahr, dass Fragen wie »Wie siehst du mich?« oder »Welche Meinung hast du von meinen Führungsfähigkeiten?« usw. Erstaunen und Verwunderung bei den Befragten auslösen. Das Image selbstsucherischer Nabelschau entsteht (»Der Alte hat heute wieder seinen sentimentalen Tag«). So ist der Einzelne auf sich selbst und seine Beobachtungen zurückgeworfen, wenn ihm nicht in einer lerngeeigneten Umgebung die Gelegenheit zu sozialem Lernen geboten wird. Da Familien und Schulen diese Funktion heute nur mehr sehr eingeschränkt erfüllen, übernehmen gleichsam kompensatorisch andere soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel auch Betriebe als Lernstatt oder Lernlaboratorien diese Aufgabe. In komprimierter Form erleben die Teilnehmer den Feedback-Prozess bei dem Soziogramm während eines Gruppendynamik-Kurses:14
...Später, beim Soziogramm, gibt es noch mehr Anlass, über Selbstbild und Fremdbild nachzudenken. Ich komme auch in Bedrängnis, meine Selbsteinschätzung, wo sie positiv ist, zu vertreten, und wo sie negativ ist, nicht zu tief zu stapeln, um bescheidener zu wirken oder gar indirekt »um Schläge zu bitten«. Die negative Quittung für meine Gefühlsäußerungen bekomme ich dadurch, dass zwei Absender mich für zu weich, nicht belastbar und überempfindlich halten und deshalb nicht mit mir als Untergebenem arbeiten wollen. Von allen anderen, und das sind mehr, als ich nach meiner eigenen Einschätzung erwartet habe, wird mir Vertrauen entgegengebracht, Verstand und Gefühl in Ausgewogenheit, Offenheit, und auch Engagement, Kreativität, Kooperationsfähigkeit und Loyalität bescheinigt. Was wünsche ich mir mehr? Mein derzeitiges Problem scheint darin zu bestehen, dieses positive Feedback und die Erfahrung von Anerkennung in meine heimatliche Umgebung mit zurückzunehmen und dort mit weniger Angst die Schwierigkeiten anzupacken. Beim Lesen der Beurteilungskarten habe ich zum ersten Mal in diesen Tagen richtig feuchte Hände. Dieses Soziogramm-Spiel ist wahrlich kein Spiel mehr. Jeder in der T-Gruppe ist längst selbst zum Forschungsgegenstand geworden, anstatt als Außenstehender am »Experiment Führungsstil« herumzulaborieren. Auch unser Typenforscher erfährt am eigenen Leib, wie weh das tun kann. Er spricht von einem dumpfen Gefühl im Bauch und Verkrampfungen im Schultergürtel. Trotzdem überleben wir alle diese erste Konfrontation mit direktem Feedback und es scheint so, als ob wir auch nach dieser bisher einschneidendsten Hürde beieinander bleiben werden. Es sieht im Gegenteil so aus, als ob wir uns in dieser relativ geschützten Gruppensituation mehr und mehr um Feedback-Geben und - Annehmen bemühen. Obwohl beides gleich schwer ist, führt der Umgang damit offensichtlich dazu, soziales Verhalten störungsfreier zu machen und Spannungen merkbar abzubauen.
Faktisch sind wir alle, besonders aber als Führungskräfte, Eltern und Trainer, auf Informationen darüber angewiesen, welche Wirkung, welche Autorität, welches Vertrauen, welche sozialen Reaktionen wir bei Mitarbeitern, Schülern, Studenten, Seminarbesuchern auslösen. Verzichten wir auf solche Informationen und wählen wir eine »Peer-Gynt-Haltung«, eine Haltung des »Sich-Selbst-Genug-Seins«, so entziehen wir uns der Chance des sozialen Lernens und verleugnen durch »Vogel-Strauß-Politik« die Realität. Solche Personen, Führungskräfte verdienen diesen Namen nicht. Sie werden früher oder später zum sozialen Außenseiter, СКАЧАТЬ