Ich - Du - Wir. Willi Lambert
Чтение книги онлайн.
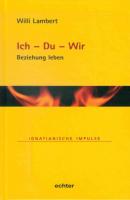
Читать онлайн книгу Ich - Du - Wir - Willi Lambert страница 3
Название: Ich - Du - Wir
Автор: Willi Lambert
Издательство: Bookwire
Жанр: Религия: прочее
Серия: Ignatianische Impulse
isbn: 9783429064853
isbn:
Für letztere Ideologie gibt es ein für mich sehr konkretes Zeugnis. Beim Herumstöbern in alten Akten in unserem seit 1921 bestehenden jesuitischen Exerzitienhaus in HohenEichen bei Dresden fand ich ein etwas zerfleddertes Exemplar eines Handbuches: UNSER LAGER. Richtblätter der Führungskräfte in den Lagern, herausgegeben vom Beauftragten des Führers für die erweiterte Kinderlandverschickung (KLV Heft Januar 1945). Dort werden als Schulungsmittel vorgestellt: Morgenfeiern, Heimabende (mit dem Monatsthema: Das Reich), Dienstunterricht, Sport, Pflichtlieder, Werkarbeit, Musikarbeit, Spielarbeit. Nachdem im Jahr 1941 die Geheime Staatspolizei (Gestapo) die Jesuiten aus unserem Haus vertrieb – einer der Mitbrüder, Otto Pies SJ, kam in das Konzentrationslager nach Dachau –, nutzte die Hitlerjugend dieses Gelände für die sogenannte »Kinderlandverschickung«. Dort wurden junge Leute im Alter von zehn bis zwölf Jahren in Schulungsferien verschickt. Sie wurden dort auf ein heldisches Leben vorbereitet, durchaus mit der Perspektive, für Führer, Volk und Vaterland das eigene Leben hinzugeben. Es sei an dieser Stelle einer von vielen Texten mit dem Titel »Wir« zitiert:
Wir!
Wir alle, durch Blut und Boden verwandt,
wir pflügen alle dasselbe Land!
Wir essen alle dasselbe Brot!
Wir tragen alle dieselbe Not!
Wir kämpfen alle mit gleichem Schwert
für unsern Acker, für Hof und Herd!
Ein Hassen, ein Lieben, ein heißes Gebet!
Ein Glaube, der alle Stürme besteht!
Ein Wille, der all unser Schaffen beseelt!
Ein Herz, das in Not und Entbehrung gestählt!
Wir alle sind eins, und ist keiner mehr Ich!
Ein Leben, ein Sterben,
Deutschland, für dich!«
(Annemarie Koeppen)
Ich und sonst niemand
Der Inhalt dieses Textes mag etwas ahnen lassen von Ziel und Methode dieser »Erziehung zu …«. Da ist kein Ich mehr, nur noch ein kollektives Ich. Die Geschichte exemplifiziert immer aufs Neue solche Modelle von Lösung, die aber regelmäßig scheitern. Zur gleichen Zeit kann die Versuchung zu einer andersartigen, aber ebenfalls menschenfeindlichen Ideologie des Individualismus praktiziert werden. Auch der kommt langsam immer mehr in die Kritik, und es zeigen sich seine ichsüchtigen Züge: Egoismus, Individualismus, Narzissmus sind geläufige Kennzeichnungen. Eine der schärfsten Formulierungen dieses »Egoismus« findet sich beim Propheten Zefanja (ca. 200 v. Chr.) im Blick auf das total zerstörte Ninive, das gegenüber dem heutigen vom IS zerstörten Mossul liegt. Ein Wanderer steht nachts vor den Trümmern der Stadt, pfeift vor Angst einsam im waldigen Chaos sich Mut zu, hebt entsetzt die Hände und ruft: »Das also ist die fröhliche Stadt, die sich in Sicherheit wiegte und dachte: Ich und sonst niemand« (vgl. Zef 2,15). Dass Ninive einen Namen hat, dass es dort Vergnügungen und Freude gibt, dass man nach angemessener Sicherheit sucht, dass es ein »Ich«, d. h. eine Identität, der Stadt gibt – das ist nicht das Problem. Das Problem ist das exkommunizierende »und sonst niemand«.
Überall wird das lebendige Wir aufgelöst, wenn es nicht zu einem gemeinsamen Du und Ich im Wir findet. Dies ist auf verschiedenste Weise in den Ideologien von Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und allen religiösen Fundamentalismen der Fall. Wie das am Ende aussieht, das zeigt Ninive. Dies ist die große, politische Ebene. Man kann aber auch an Gruppen von organisierten Untätern denken, die schon Kinder zu sexuellen Opfern abrichten, foltern, für kinderpornographische Filme im Darknet missbrauchen. Einer ihrer Grundsätze lautet: »Du bist Dreck und hast nur unseren Interessen zu dienen …«. – »Aber das gibt es doch nicht bei uns!« Doch, nicht nur in Ninive und anderswo, sondern auch in Europa, in Deutschland. – Papst Franziskus spricht von »globaler Gleichgültigkeit«, man könnte auch sagen von einer universalen Überforderung, wenn wir uns nicht zu einem wirklichen, menschenfreundlichen Wir verbünden, zusammenarbeiten, und dies auf den persönlichen, betrieblichen, wirtschaftlichen, nationalen, europäischen und weltweiten Ebenen.
Vom Ich zu »ziemlich besten Freunden«
Vielleicht wäre es zu viel verlangt, wenn wir alle »ziemlich beste Freunde« würden, so der bekannte Buch- und Filmtitel, dem ein wirkliches Lebensschicksal zugrunde liegt: Der erfolgreiche Unternehmer Philippe Pozzo di Borgo ist durch einen Gleitschirmunfall von den Schultern an gelähmt, bekommt Hilfe durch einen charakterlich und lebensmäßig gänzlich anderen Typ von Mensch, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Monatelang liegt Pozzo di Borgo im Bett und kann nur an die weiße Decke schauen. Dabei findet er sich selber und entdeckt die anderen als andere. So entwickelt sich bei ihm eine »Weltanschauung«, die in seinem neuesten Buch greifbar wird. Sein Anliegen fasst er mit den Worten zusammen: »In unserer Gesellschaft herrscht das ›Ich‹ vor. Doch der Individualismus führt in eine Sackgasse, was durch die derzeitige Krise deutlich zutage tritt, und wir sind aufgerufen, eine neue Form des Zusammenlebens zu finden. Dabei muss das ›Du‹ in einer friedlichen und bereichernden Beziehung das ›Ich‹ ausgleichen. Überspitzt formuliert: Gestern hieß es ›Ich‹ gegen ›die‹. Heute sollten wir in Betracht ziehen, dass aus ›denen‹ ›ihr‹ werden kann und dass ›Ich und Du‹ schlicht und einfach ›Wir‹ sind. Eine Revolution der sozialen Beziehungen.«1
Ich kommuniziere, also bin ich
Leben ist Kommunizieren
Sein ist Beziehung, anders gibt es Wirklichkeit nicht. Leben lernen heißt kommunizieren lernen. Zu den bekanntesten Formulierungen aus der Philosophie gehört das Wort von Descartes: »Ich denke, also bin ich.« Diese Erfahrung, in welcher der Philosoph sich als denkendes Wesen wahrnimmt, ist für ihn ein unerschütterliches Fundament der Selbstvergewisserung seiner Existenz. Der bayerische Bergrat und Theo-Philosoph Franz von Baader (1765–1841) greift ausdrücklich dieses Wort auf und erweitert das lateinische »cogito ergo sum« durch den Buchstaben »r« zu »cogitor ergo sum«: »Ich werde erkannt, also bin ich.«
Vor Jahren sah ich an einer Bushaltestelle in München ein großes Plakat mit den Worten: »Ich kommuniziere, also bin ich.« Stärker kann es kaum ausgedrückt werden, worum es in diesem Buch geht, nämlich um das Verständnis von Wirklichkeit als Beziehung oder, wie Martin Buber einmal formuliert: »Alles wirkliche Leben ist Begegnung.« Man kann dem aus der religiösen Denk-, Erfahrungs- und Sprachwelt gesprochen hinzufügen: »Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit.« So ähnlich formuliert Ignatius dies im Exerzitienbuch. Der Begleiter solle den begleiteten Menschen helfend zur Seite stehen, aber wichtiger sei es, darauf zu vertrauen, dass der gottsuchende Mensch von Gott in Liebe umfasst und umarmt wird. So wird in ihm Liebe erweckt (vgl. EB 15). Und genau dieses Geschehen ist der Punkt, um den sich alles in СКАЧАТЬ